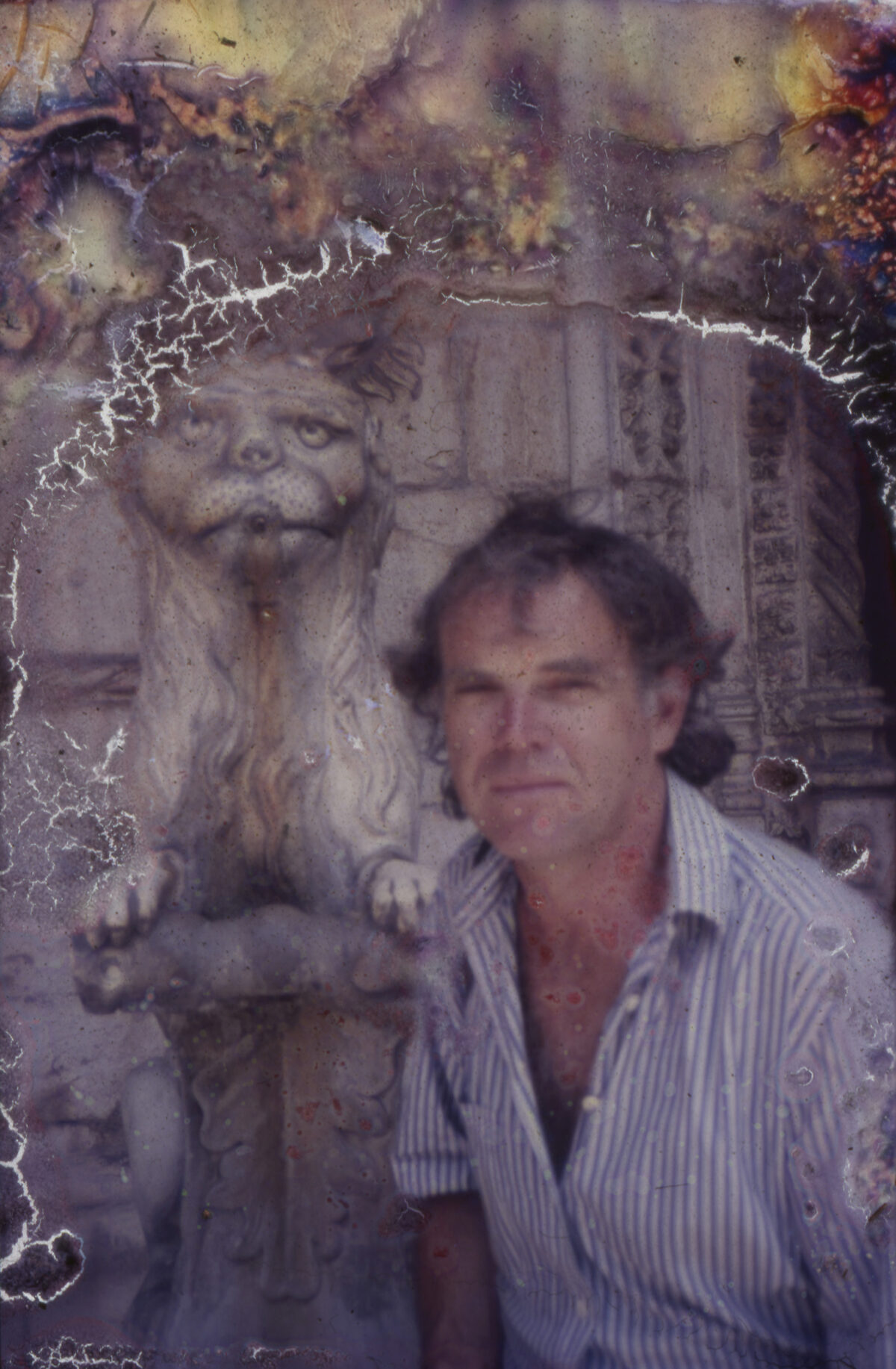FUTUR I
Juli 2016
Die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt strahlt am frühen Abend eine Sondersendung aus. „Militärputsch in der Türkei. Am Vortag Anschlag in Nizza. Uns erreichen äußerst beunruhigende Nachrichten aus der Türkei. Es gibt Gerüchte, dass dort ein Putschversuch des Militärs im Gange sei. Was wir wissen, ist zur Zeit, in Ankara waren offenbar Schüsse zu hören, Kampfhubschrauber kreisen über der türkischen Hauptstadt. In Istanbul sind offenbar beide Brücken über den Bosporus gesperrt. Unbestätigte Berichte sagen, die Polizei wird entwaffnet. Twitter-Meldungen bestätigen den Militärputsch. Wie groß und wie weit der reicht, weiß man noch nicht, aber es ist wohl ein offener Kampf innerhalb des Militärs.
Es ist ganz offen, was passieren wird.“
HEIMAT
In der Mitte von Düsseldorf gibt es eine Insel.
Auf würzigen Feldern grasen Ziegen und Schafe.
SCHWARZER SCHNEE
Mein Name ist Isabelle Kaya.
Ich erzähle meine Geschichte.
Wie es war und nicht wie es sein könnte.
Wenn ich an den letzten Abend mit meiner Mutter denke, erinnere ich mich an ihre Hände, die weiße Bohnen wuschen. Kleine Tränen Wasser kullerten ihren zierlichen Handrücken herunter. Sie stand in unserer Küche, einem kleinen dunklen Raum. In der Mitte ein großer eiserner Ofen. Dieser Ort meiner Kindheit roch köstlich. Oft nach frisch gebackenem Fladenbrot. Ich erinnere mich, wie es mir gefiel, die Sesamkörner wie schwarzen Schnee auf das Brot fallen zu lassen.
Erst der Akt des Erinnerns macht ein Gedächtnis möglich.
Ich habe so oft an meine letzten Erinnerungen gedacht und jetzt wusste ich gar nicht mehr, ob sie Wirklichkeit waren. Es mochte sein, dass die Zeit mich täuschte.
*
Es war noch dunkel, als mein Vater mich ins Auto trug und mit mir nach Deutschland fuhr. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Baba sagte, die Fahrt würde achtzig Stunden dauern. Er erklärte, das wären vier Nächte und drei Tage. Ich zählte das zusammen. Das Ergebnis war sieben. Eine ganze Woche.
An viel mehr kann ich mich nicht erinnern. Außer an das Wort „Gastarbeiterroute“, das klang lustig. Und dass ich auf der Autobahn Geburtstag hatte. Es war eine traurige Fahrt. Baba weinte oft. Die Tränen kamen wie aus dem Nichts und fluteten ihn. Ich traute mich nicht zu fragen, warum Maman nicht mit uns gekommen war.
Als wir über die deutsche Grenze fuhren, wusste ich nicht, dass hier meine neue Heimat sein sollte und ich das Land meiner Geburt für eine sehr lange Zeit nicht wiedersehen würde.
Bei der Abfahrt aus Istanbul war ich fünf Jahre alt, bei der Ankunft in Deutschland war ich sechs.
*
ISABELLE
Wie gesagt, mein Name ist Isabelle Kaya und ich habe mein ganzes Leben in Deutschland verbracht. Wenn ich mich richtig erinnere.
BABA
Mein Vater ist Harun Kaya. Er ist Kranführer.
Als ich neun Jahre alt war, durfte ich an einem Sonntag mit hinaufsteigen. Das war toll. Ein großartiges Gefühl, von oben auf die Welt hinunter zu schauen. Die Menschen waren so klein.
Harun Kaya, mein Vater, ist ein registrierter Terrorist, weil er Kurde ist.
Alle Kurden sind für die türkische Regierung Terroristen, das war schon vor Erdogan so. Und das war der Grund, warum wir, als ich fünf Jahre alt war, Hals über Kopf, in der Nacht, unsere Heimat Istanbul verlassen mussten, glaube ich.
Baba war ein politisch engagierter Schauspieler in der Türkei, bevor er nach Deutschland kam und auf der Baustelle arbeitete.
MAMAN
Ihr Name ist Anette. Anette Thomas.
Meine Mutter stammt aus Bossugan, einem Dorf südlich von Bordeaux. Bossugan kommt auf 47 Einwohner und drei Schlösser, die versteckt zwischen grünen Hügeln liegen. Nicht weit entfernt brachen die Wellen des Atlantischen Ozeans. Die Dünen glitzerten silbrig in der Sonne und trennten das Meer vom Pinienwald.
Ich war noch nie in Bossugan. Ich war überhaupt noch nie in Frankreich. Das mit den Dünen und den drei Schlössern hatte ich auf der Internetseite „France Voyage“ entdeckt.
Die stärkste Erinnerung an Anette Thomas ist der Name, den sie mir geschenkt hat, Isabelle. Das ist auch die einzige Erinnerung, auf die ich mich verlasse.
Erst der Akt des Erinnern gründet ein Gedächtnis.
Aber beruhen frühe Erinnerungen in Wahrheit nicht auf Erzählungen Anderer? Erinnerungen können erzeugt werden. Man zeigt Erwachsenen manipulierte Bilder aus ihrer Vergangenheit und sie erinnern sich daraufhin an Dinge, die nicht stattgefunden haben.
Ich erinnere mich verschwommen an meine Mutter. Hinter der Spinnennetzfolie des Fotoalbums lauern viele leere zigarettengelbe Seiten und eine Handvoll fotografisch festgehaltener Momente, Millisekunden. Tausendstel. Hunderttausendstel.
Als Kind war Maman für mich bunt. Mit der Zeit verblasste sie, bis sie schließlich nur noch eine schwarz-weiße Person auf ausgeblichenem Fotopapier war. Eine schwarz-weiße Person aus einem fremden Leben, in einem fremden Land. Eingesperrt in einem Bild. Auf allen Fotografien, es sind vier, eigentlich fünf, rechnet man das Hochzeitsfoto, welches in Babas Nachttischschublade liegt, mit, trägt sie ihre schwarzen Haare fest zu einem Pferdeschwanz gebunden. Durchsichtige Haut, dunkle Augenringe, abgemagert und von kleiner Statur. Sie schien für immer zu verschwinden. Nur in ihrem Gesicht lag ein Ausdruck von Stärke. Wenn ich ihr Foto ansah, was ich stundenlang tat, als ich noch klein war, schien ihr Blick sich nur auf mich zu richten. Um mir etwas mitzuteilen. Mir, das einzig Wichtige, das Essentielle mitzugeben. Doch ich verstand nicht, was sie mir sagen wollte.
Als ich klein war, dachte ich immer, Maman wäre schrecklich krank. Krebs oder so. Als ich etwas älter wurde, dachte ich, sie wäre verrückt geworden und gestorben. An schwarzem Herzen. Auf einer Fotografie war ihre Wimperntusche zu einem breiten schwarzen Streifen verschmiert. Sie sah aus, als sei sie hinter Gittern.
Sie war nicht gestorben, jedenfalls nicht im herkömmlichen, allgemeinmedizinischen Sinne.
Sie war am Leben.
Doch für mich blieb sie verschwunden.
Über 20 Jahre lang.
Ein Foto von mir gehört auch zu dem dünnen Stapel. Ich weiß gar nicht, wie es dort hineingeriet. Als ob mich irgendwer zu Maman stecken wollte. Seht her, das sind Mutter und Tochter! Sie gehören wirklich zusammen.
Doch auch diese Erinnerung ist nur Einbildung, Teil meiner Fata-Morgana-Familie.
Auf dem Bild sitze ich hinterm Steuer unseres Autos, einem weißen Opel. In diesem Wagen feierte ich Geburtstag und kam nach Deutschland. Verdeckt sitzt Baba an einem Campingtisch vor unserem Zelt. Ich denke, dass es unser Zelt ist, erinnern kann ich mich nicht. Sind wir nicht nonstop von Istanbul nach Hamburg gefahren? Nur mal kurz auf Toilette gehen, Benzin nachfüllen, Wasser kaufen. Zitternd auf der Rückbank, nicht angeschnallt, gekrümmt, der Zigarettenqualm, verheult, Maman, warum bist du nicht hier?
Zelten. Einpacken, auspacken, anhalten, aufbauen, abbauen, wegfahren.
Wo soll das gewesen sein? Bulgarien, Jugoslawien oder schon Österreich?
Beruhen Erinnerungen nicht auf Erzählungen Anderer?
ÜBERALL ZUKUNFT
Es war unmöglich, mir meinen Vater jung oder rebellisch vorzustellen.
In Deutschland war er ein Unsichtbarer, ein Gastarbeiter mit eingezogenem Kopf, kraftlos in einen Arbeitsanzug gesperrt, mit Bloß-nicht-auffallen-Pass ausgestattet. Er achtete penibel darauf, alle Gesetze und Gebote des Gastlandes zu befolgen. War er krank, fuhr er anstatt zum Arzt zur Baustelle.
Als ich das erste Mal beim Schwarzfahren erwischt wurde, reagierte er, als habe ich einen Mord begangen. Er zog die schweren Vorhänge zu und redete nicht mehr mit mir. Das Gras, das über die Sache wachsen sollte, wuchs langsam und bevor es eine Wiese wurde, erwischten die Kontrollettis mich ein weiteres Mal. Ein Dutzend Arbeitsstunden im Altenheim inklusive zwei tote Omas im Kellerraum aufbahren beschäftigten mich die nächsten Wochen. Ich hatte viel Zeit nachzudenken und fasste den Entschluss, mich nie wieder erwischen zu lassen. Und Baba, der beschloss, die Zugbrücke zu seinen Herzen hochzuziehen. Ich wusste, dass er mich nur beschützen wollte. Ich war ungezähmt, wild, wurde schnell wütend. Ich wollte auf keinen Fall unsichtbar werden. Ich war hier und jetzt und wollte überall zeitgleich sein.
Nicht auffallen war das Eine und Integration das Andere. Ich sollte gefälligst eine Heimat finden, denn Heimat war sehr wichtig. „Heimat ist da, wo das Herz schlägt“, sagte Baba jeden Abend, wenn er mich zu Bett brachte.
Nicht auffallen, aber integrieren funktionierte irgendwie nicht so bombig. Jedenfalls nicht bei mir. Die Kita-Erzieherinnen sprachen von mir als „munterem Kind, das neugierig auf die Welt“ sei. Ich bin keine Psychologin, aber vom Hier und Jetzt aus betrachtet, denke ich, sie meinten eher biestig und sauer. Ich lernte schnell Deutsch und wurde etwas weniger sauer. Wild und ungezügelt blieb ich. Sauer wurde ersetzt durch traurig. Warum, kann man sich denken.
BESUCH
Wir bekamen nie Besuch.
Ich durfte keine anderen Kinder mit nach Hause bringen. Baba erlaubte mir aber, nach der Schule mit meinen Freundinnen mitzugehen. Er war ja immer auf der Baustelle.
An den Wochenenden übernachtete ich meistens bei meinen Freunden. Bei denen war es so gemütlich, die lebten richtig in ihren Wohnungen, wogegen Baba und ich eher in einer Hotelzimmerwohnung schliefen. Und was die Anderen alles zuhause durften!
Einige Freundinnen nannten ihre Eltern beim Vornamen und sagten „Du, Frederike, können wir Pokémon gucken?“ oder „Du, Olaf, können ich und Isabelle noch mehr Cola?“. Otto und Ben, die alleinerziehende Sibylle, Kami und Emiel, Banu und Dieter und wie sie alle hießen. Ich liebte die Vornamen und benutzte sie gerne. Ich rief sie laut durch die Stadtwohnungen. Ich liebte meine vielen neuen Familien, alle meine Babas, alle Mamans, mes soeurs und mes frères.
An diesen Wochenenden aß ich mit den neuen Familien gemeinsam zu Abend. Bei Baba und mir aß jeder, wenn er Hunger hatte. Die eine Familie kam am Küchentisch zusammen, die andere im Wohnzimmer. Banu und Dieter hatten eine riesige Bar, auf der das Essen wie bei einem festlichen Buffet angerichtet wurde. Die Bar hatte Banu selbst entworfen und gebaut.
Es waren fantastische Ländermix-Gerichte. Chinesisch-dänische Küche, türkisch-deutsche, indisch-marokkanische, deutsch-portugiesische. Vegetarisch, vegan, Ziegenfleisch und Rinderzunge, Käsefondue und Königsberger Klopse, Ragout fin, Fischpastete und Pasta, wie die Nutten sie mögen. Straußenfleisch-Burger, Seetang und äthiopisches Injera.
Das Wohnen mit Baba war wie ein Leben aus einer alten, vergessenen Epoche, die es nur in Büchern gab. Ein staubiger Lampenschirm, ein verschlissener Orientteppich unter einem Glastisch vom Sperrmüll. Mit jedem Jahr entfernte ich mich einen Schritt weiter von meinem Vater. Irgendwann würde er nur noch ein kleines Männchen am Horizont sein, bevor er ganz verschwand. Doch auch wenn mich der Sturm von ihm wegtrieb, ich ruderte dagegen an, von Zeit zu Zeit, in schlaflosen Morgenstunden, nach alptraumhaften Nächten. Könnte er nicht mein Leuchtturm sein, das helle Licht am Ende der Welt?
Er war nicht immer so. So… heimatlos? Kraftlos? Ausgepustet? Erstickt?
Es gab ein anderes Leben, ein Leben mit Maman, ein Leben vor mir und sogar ein gutes Leben mit mir. Ein Leben in Istanbul. Ich versuchte, mir aus den wenigen Bruchstücken, die er ab und an liegen ließ, mein Bild von ihm zusammenzusetzen. Laufen gelernt haben meine Bilder nie. Sie liegen vor mir und ergeben wenig Sinn. Bruchstücke. Als wir neu in Deutschland waren, habe ich Baba viele Fragen gestellt. Antworten gab es nicht. Als ich 14 wurde, wünschte ich mir von ihm nichts und alles. Die Wahrheit, die Geschichte meiner Eltern. Ich wollte ihn verstehen und lernen, mich selber zu verstehen. Am Tag meines Geburtstages stand auf dem Küchentisch eine Handtasche aus Leder, schwarz, verziert mit silbrigen Steinchen, ohne Geschenkpapier. Er sagte „Doğum günün kutlu olsun, herzlichen Glückwunsch“. Keine Antworten, keine Wahrheit. Ich fasste die Tasche nicht an. Tage später war sie verschwunden. Ein Zwanzig-Euro-Schein auf eine Tafel Milka-Vollmilchschokolade geklebt ersetzte sie.
Ich nahm das Geld und aß die Schokolade. Das Geld versteckte ich. Ich würde es noch brauchen. Damals wollte ich zum ersten Mal abhauen.
Das Wenige, was ich wusste, war, dass wir das Land unserer Väter verlassen mussten. Baba sagte Sätze wie: „Es gibt kein Zurück. Deine Mutter hat sich gegen uns entschieden. Gegen dich.“ Irgendwann wiederholte Baba nur noch den einen Satz, ausdruckslos sagte er: „Die Wärme in meinem Land ist verloren gegangen. Ich musste gehen.“ Und irgendwann wollte ich gar nichts mehr hören. Meine Eltern wurden mir egal. Meine Mutter hatte mich im Stich gelassen, als fünfjähriges Kind, und mein Vater hatte, um seine Haut zu retten, alles verlassen, was er liebte, und nun hatte er als Strafe mich am Hals.
Mein Bild von der Türkei und vor allem von Istanbul erschuf ich durch Zeitungsartikel. Ich wählte in der Schule bei Projektarbeiten das Thema „Istanbul in den Neunziger Jahren“. Alle Türken auf meiner Schule kannten mehr Geschichten über die Türkei als ich. Und das waren noch nicht mal Türken, die sind alle hier geboren. In einem Kreißsaal, in einem Krankenhaus, in Düsseldorf, Deutschland, EU. Baba und ich machten nie Ferien in der Türkei und auch sonst nirgendwo. Ich fuhr alleine mit dem 739er Bus mit Ferienpass ins Stadtteil-Freibad.
Was ich weiß, ist, dass mein Vater den Putsch von 1980 erlebt hat, als junger Mann. Damals war er in linken Künstlerkreisen aktiv, wo er Maman kennenlernte. Bei einem Wohnprojekt. Sie hat fotografiert, war Fotografin. Nur wenige Fotos sind mir von ihr geblieben. Ich habe mich immer gefragt, ob durch die Bedrohung des Staates ein Riss durch unsere Familie ging. Und wenn ja, was macht so ein Riss? Reißt er den Körper in der Mitte durch, in zwei gleichgroße Hälften? Einbeinig, unfähig zu gehen, einarmig, unfähig zu umarmen? Hatte mein Vater meine Mutter verraten? Oder umgekehrt? Waren sie Spione? Für wen und was hat wer, wann und warum verraten? Wollte er sie retten oder sie ihn? Hat er sich geopfert oder sie sich? Oder bin ich das Opfer? Hat mich Maman nicht geliebt? Warum ist sie nicht nachgekommen? Wollten sie mich beschützen vor dem Geheimdienst oder vor Baba oder vor …?
Ich musste damit aufhören. Mit den tosenden Fragen, die mir den Verstand wegspülten, die mich zerrissen, ausspuckten, mich auslachten, mich reizten, mich betrogen, mich verführten und verhörten.
Spekulationen! Verschwörungen, die irgendwann zur Wahrheit werden würden. Nicht zur wahrhaftigen Wahrheit. Nur zu meiner Wahrheit. Das ist Tatsache. Das ist Bewusstsein. Diese Erkenntnis ist meine Rettung. Sie wiegt schwer, ist traurig. Doch eine andere Lösung kenne ich nicht. Keine Rettungsgasse, keine Weggabelung, keine Schüssel voller Gold am Ende des Regenbogens. Rien! C’est la vie.
C’est ma vie.
Mein eigenes Leben.
Ohne Maman.
Ohne Baba.
Nur Ich. Isabelle.
Die Entscheidung habe ich getroffen.
Zukunft ist überall.
Das ist meine Zukunft.
Jonny Bauer